Von Google ⓘ
01.04.2025
Fabian Flemig
Ich wurde hier sehr kompetent beraten und ich musste nur minimalsten Aufwand betreiben für einen Versicherungsabschluss.

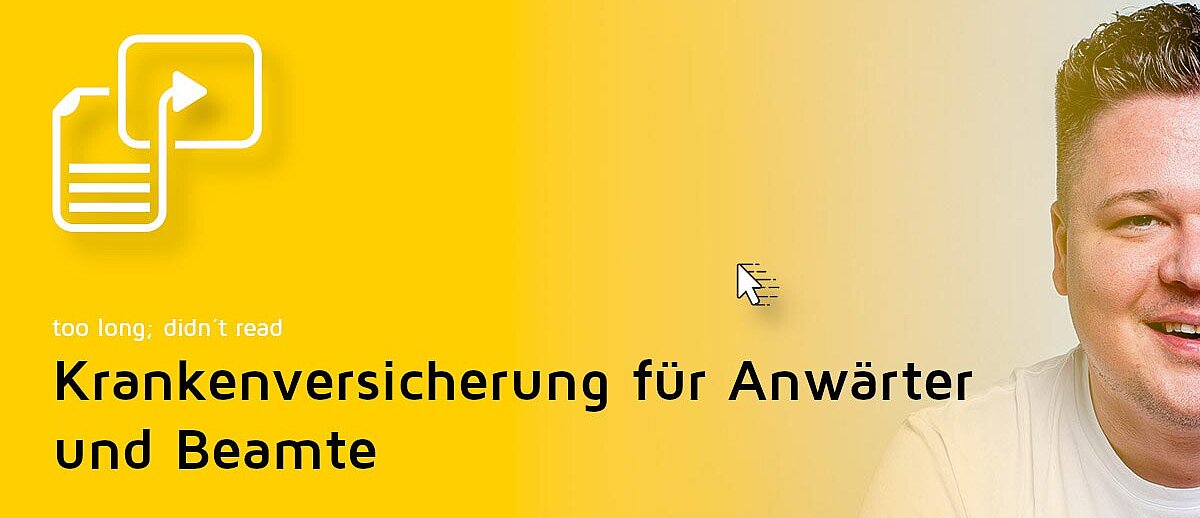
Zur Absicherung gegen finanzielle Belastungen im Krankheitsfall besteht in Deutschland seit dem 01.01.2009 eine allgemeine Krankenversicherungspflicht. Demnach sind Menschen mit Wohnsitz in Deutschland verpflichtet, krankenversichert zu sein. Geregelt ist dies für die GKV in § 5 SGB V, für die PKV in § 193 VVG. Wer gemäß § 6 SGB V nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert ist, hat die Wahl zwischen einer freiwilligen Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenkasse und der Absicherung in der privaten Krankenversicherung. Für Beamte und Beamtenanwärter besteht dieses Wahlrecht, wenn sie nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Fortzahlung ihrer Bezüge und auf Beihilfe bzw. Heilfürsorge haben - zu diesen besonderen Krankensicherungssystemen im öD später mehr.
Die Möglichkeit, sich zwischen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung entscheiden zu dürfen, ist ein Privileg, das in Deutschland nur rund 20% der Bevölkerung genießen. Fast 80% der Krankenversicherten sind GKV-Pflichtmitglieder bzw. GKV-versicherte Rentner sowie mitversicherte Familienangehörige. Es empfiehlt sich daher für Beamte und Anwärter, dieses Privileg sinnvoll zu nutzen.
GKV und PKV unterschieden sich in einigen wesentlichen Punkten sehr deutlich voneinander:
GKV
Die gesetzliche Krankenversicherung finanziert sich aus den Beiträgen ihrer Mitglieder und Steuerzuschüssen im Umlageverfahren. Somit werden Einnahmen grundsätzlich unmittelbar zur Deckung entstehender Kosten verwendet. Umfangreichere Rücklagen bildet die GKV insofern prinzipiell nicht. Der zu zahlende GKV-Beitrag richtet sich - bis zur Beitragsbemessungsgrenze - regelmäßig nach der Höhe des persönlichen Einkommens (Solidarprinzip) - wer mehr verdient, zahlt also einen höheren Beitrag. Das Alter und der Gesundheitszustand des Mitglieds spielen hingegen für den Beitrag keine Rolle. Der Beitragssatz setzt sich aus einem gesetzgeberseitig vorgegebenen allgemeine Beitragssatz (§ 241 SGB V) und einem kassenspezifischen Zusatzbeitrag (§ 242 SGB V) zusammen. Im Jahr 2024 liegt der durchschnittliche Beitragssatz bei 16,3 % der beitragspflichtigen Einnahmen des jeweiligen Mitglieds. Dazu zählen grundsätzlich alle Einkommensarten - folglich beispielsweise auch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Einnahmen aus Kapitalvermögen, Betriebsrenten, Rentenzahlungen aus Versorgungswerken und Unterhaltszahlungen. Die Höhe des Beitrags kann sich sowohl durch die gesetzgeberseitige Änderung des allgemeinen Beitragssatzes als auch durch die kassenspezifische Anpassung des Zusatzbeitrags verändern. Angehörige können unter den Voraussetzungen des § 10 SGB V im Rahmen der Familienversicherung mitversichert werden.
PKV
Die Finanzierung der PKV erfolgt aus den Beiträgen der Krankenversicherten im Kapitaldeckungsprinzip. Die Beiträge beinhalten somit einen Sparanteil, aus dem künftige Versicherungsleistungen an den Versicherten bedient werden können. Daher gehen steigende Gesundheitsausgaben älterer Krankenversicherter nicht zu Lasten jüngerer Generationen. Der spezifische PKV-Beitrag eines Krankenversicherten hängt im Wesentlichen von dessen Alter und Gesundheitszustand bei Vertragsabschluss sowie von den gewählten Versicherungsleistungen ab (Äquivalenzprinzip). Die Voraussetzungen für Beitragsanpassungen im Zeitablauf sind gesetzlich bzw. vertraglich geregelt und können gemäß § 203 VVG nur erfolgen, wenn vordefinierte Schwellenwerte überschritten werden und ein unabhängiger Treuhänder die Voraussetzungen für die Änderungen überprüft und ihre Angemessenheit bestätigt. Beihilfe-Berechtigte können aufgrund der anteiligen Krankheitskostenübernahme in Form der Beihilfe von besonders günstigen Beiträgen profitieren. Anders als bei gesetzlichen Krankenkassen bieten Beitragsrückerstattungen und wählbare Selbstbeteiligungen den Krankenversicherten merkliche Anreize, nur sinnvolle bzw. erforderliche Versicherungsleistungen zu beanspruchen und damit die Mittel des Versichertenkollektivs im Interesse all seiner Mitglieder umsichtig und schonend zu behandeln. Dementsprechend erhöhten sich die Beiträge zur privaten Krankenversicherung zwischen 2004 und 2024 nur um durchschnittlich 2,8 % pro Jahr, während die Beiträge zur GKV im selben Zeitraum jährlich um durchschnittlich 3,2 % gestiegen sind.
GKV
Der Leistungsumfang der GKV - der sogenannte Leistungskatalog - ist durch das SGB V und ergänzende Richtlinien weitestgehend vorgegeben. Das Wirtschaftlichkeitsgebot des § 70 Abs. 1 S. 2 SGB V schreibt dabei vor, dass die Versorgung ausreichend und zweckmäßig sein muss, das Maß des Notwendigen nicht überschreiten darf und in der fachlich gebotenen Qualität sowie wirtschaftlich zu erbringen ist. Zahlreiche Leistungen, wie zum Beispiel Ein- bzw. Zweitbettzimmer und Chefarztbehandlung im Krankenhaus, alternative Heilbehandlungen, Zahnersatzleistungen und professionelle Zahnreinigung, Sehhilfen, Krankenversicherungsschutz im Ausland und Reiseimpfungen sowie einige Behandlungsverfahren und Arzneimittel werden von den gesetzlichen Krankenkassen in der Regel nicht oder nur eingeschränkt übernommen. Außerdem sind die derzeitigen Kassenleistungen nicht für die Zukunft garantiert, sondern können sich jederzeit durch eine Gesetzänderung reduzieren. Einschränkungen der gegenwärtigen Versicherungsleistungen sind somit möglich und angesichts der derzeitig angespannten Finanzlage in der Sozialversicherung nicht unwahrscheinlich.
PKV
Anders als in der gesetzlichen Krankenversicherung ist die verfügbare Leistungsbandbreite der einzelnen privaten Krankenversicherer und ihrer Versicherungstarife sehr groß. Als Rahmen gesetzlich vorgegeben ist in § 192 VVG lediglich, dass Versicherungsgesellschaften verpflichtet sind, im vereinbarten Umfang die Aufwendungen für medizinisch notwendige Heilbehandlung wegen Krankheit oder Unfallfolgen und für sonstige vereinbarte Leistungen zu erstatten. Der vereinbarte Umfang eines Tarifs ergibt sich aus dem jeweiligen Versicherungsvertrag. Die enorme Leistungsvielfalt ermöglicht es PKV-Versicherten, sich ihre gewünschten Leistungen passgenau zusammenzustellen und dementsprechend auch ihren Beitrag maßzuschneidern. Außerdem ist der gewählte Leistungsumfang - auch für die Zukunft - sicher, da er zwischen der Versicherung und dem Krankenversicherten vertraglich vereinbart wird. Ein ausführlicher Vergleich vor Abschluss einer privaten Krankenversicherung lohnt sich daher sehr.
GKV
In der gesetzlichen Krankenversicherung wurde mit dem Gesundheitsstrukturgesetz von 1992 das Prinzip der Budgetierung von Leistungsausgaben eingeführt. Dabei wird je Kalenderjahr vorab festgelegt, welche Gesamtvergütung den gesetzlichen Krankenkassen maximal für die Behandlung von GKV-Versicherten zur Verfügung steht. Die Verteilung dieser limitierten Mittel zwischen den einzelnen Fachgruppen und Ärzten folgt komplexen Regeln - unter anderem dem einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) - und kann zu Verteilungskämpfen sowie eingeschränkter Abrechenbarkeit erbrachter Dienstleistungen bzw. in Extremfällen sogar zu Regressforderungen gegen Ärzte führen. Sind die vorgegebenen Budgets ausgeschöpft, können Leistungseinschränkungen die Folge sein. Die Auswirkungen spüren gesetzlich Krankenversicherte unter anderem bei teils deutlich längeren Wartezeiten und fehlenden Terminen. In Kombination mit dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung führt die Budgetproblematik außerdem dazu, dass bestimmte Behandlungen bzw. Medikamente gar nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sind.
PKV
In der privaten Krankenversicherung existiert keine vorab definierte Budgetobergrenze für Leistungsausgaben. Erbrachte Behandlungsleistungen können Ärzte nach der jeweils einschlägigen Gebührenordnung abrechnen. Relevant sind in der Humanmedizin insbesondere die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) und die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ). Auf dieser Basis können prinzipiell alle erbrachten ärztlichen Dienstleistungen abgerechnet werden, soweit sie medizinisch notwendig und vom Leistungsumfang der jeweils gewählten Tarife umfasst sind. Daher können Privatversicherte neben zeitnahen Terminen und geringen Wartezeiten sowie freier Arzt- und Krankenhauswahl auch von den modernsten bzw. wirksamsten Behandlungsmethoden und Arzneimitteln profitieren, die das deutsche Gesundheitssystem bietet.
GKV
Um Kassenpatienten ärztlich behandeln zu dürfen, muss ein Arzt zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassen sein (Kassenzulassung). Mit der Zulassung zur Teilnahme eines Arztes an der vertragsärztlichen Versorgung verpflichtet sich der Vertragsarzt - umgangssprachlich auch Kassenarzt genannt - zur Behandlung von Kassenpatienten aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der gesetzlichen Versicherung. Kassenpatienten können daher im Rahmen ihres Versicherungsschutzes durch die gesetzliche Krankenversicherung grundsätzlich nur unter Vertragsärzten frei wählen, was die freie Arztwahl einschränkt. Erbrachte Dienstleistungen rechnet der Vertragsarzt regelmäßig innerhalb des Budgets und des Leistungskatalogs mit der jeweiligen Krankenkasse bzw. mit der kassenärztlichen Vereinigung ab (Sachleistungsprinzip). Hiervon ausgenommen sind zahlreiche zusätzliche Leistungen, die nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Diese Wahlleistungen bzw. individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) können Kassenpatienten auf eigenen Wunsch beanspruchen, müssen diese jedoch aus eigener Tasche zahlen und direkt mit dem Vertragsarzt abrechnen, sofern sie nicht durch eine gesonderte private Krankenzusatzversicherung abgesichert sind. Welche Dienstleistungen Vertragsärzte direkt mit der Krankenkasse abrechnen und welche Kosten für erfolgte Behandlungen in Rechnung gestellt werden, ist für Kassenpatienten in der Regel weitgehend intransparent: Zwar haben Kassenpatienten gemäß § 305 Abs. 2 SGB V das Recht, sich über erhaltene Leistungen eine Patientenquittung ausstellen zu lassen. Dies geschieht allerdings nur auf expliziten Wunsch, ist teilweise kostenpflichtig und wird tatsächlich sehr selten genutzt. Diese Intransparenz leistet keinen positive Beitrag zur Kostendisziplin in der gesetzlichen Krankenversicherung. In der Praxis erleben wir es daher regelmäßig, dass Kassenpatienten, die für eine Versicherungsberatung ihre Patientenakte anfordern, teilweise über die darin vermerkten Diagnosen bzw. die abgerechneten Positionen recht überrascht sind.
PKV
Für privat Krankenversicherte gilt das sogenannte Kostenerstattungsprinzip. Demnach werden erbrachte Leistungen grundsätzlich zwischen dem Krankenversicherten und dem Leistungserbringer abgerechnet. Zu den Leistungserbringern zählen neben Ärzten beispielsweise auch Krankenhäuser und Apotheken. Welche Behandlungen erfolgen, welche Diagnosen gestellt und in der Patientenakte vermerkt werden und welche Honorare dafür anfallen, ist für Privatversicherte daher sehr transparent. Die Rechnungen können Privatversicherte innerhalb der geltenden Frist - in der Regel binnen drei Jahren gemäß § 195 BGB - zwecks Erstattung bei ihrer privaten Krankenkasse einreichen. Viele PKV-Anbieter stellen für die Rechnungseinreichung einfache und komfortable Verfahren zur Verfügung - beispielsweise eine App, mit der Belege abfotografiert und an die Versicherung gesendet werden können. Beihilfeberechtigte können mithilfe eines ähnlichen Verfahrens die Rechnungen auch bei der Beihilfestelle zwecks Erstattung des Beihilfeanteils einreichen. Der PKV-Anbieter prüft die Rechnung auf Basis des vereinbarten PKV-Leistungsumfangs und erstattet die Kosten für die medizinische Versorgung an den Versicherungsnehmer. Liegen der Versicherung alle erforderlichen Informationen vor, hat die Erstattung gemäß § 14 VVG innerhalb eines Monats zu erfolgen. Ab einer voraussichtlichen Rechnungssumme von 2.000 Euro können Privatversicherte gemäß § 192 Abs. 8 VVG sogar eine verbindliche Vorabauskunft ihres Krankenversicherers verlangen, inwieweit dieser die betreffenden Kosten übernimmt.
Als allgemeine Kriterien solltest du bei der Auswahl der für dich besten privaten Krankenversicherung - teilweise auch privaten Beihilfeversicherung, beihilfekonforme Krankheitskostenversicherung bzw. Restkostenversicherung genannt - insbesondere folgende Aspekte berücksichtigen:
Das Leistungsspektrum der am Markt verfügbaren privaten Krankenversicherungstarife reicht von günstigen Tarifen mit geringerem Leistungsumfang bis hin zu leistungsstarken Top-Tarifen. Dabei setzt sich eine PKV in der Regel aus verschiedenen Tarifbausteinen zusammen (Bausteintarife). Jeder dieser Bausteine definiert üblicherweise einen konkreten Leistungsumfang für einen bestimmten Leistungsbereich. Leistungsbereiche sind üblicherweise: ambulanter Bereich, stationärer Bereich, Zahn, Beihilfeergänzung, Auslandsreise, Krankentagegeld, Krankenhaustagegeld, Kurtagegeld, Pflege, Pflegezusatz und Beitragsentlastung. Die einzelnen Leistungsbausteine können innerhalb gewisser Grenzen frei kombiniert werden. Dadurch lässt sich der Leistungsumfang je Leistungsbereich nach den persönlichen Anforderungen und Wünschen zusammenstellen. Neben Bausteintarifen werden auch sogenannte Kompakttarife angeboten, die mehrere Leistungsbereiche zu einem Leistungspaket zusammenfassen. Die Einzelheiten der jeweils abgesicherten Leistungen werden in Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB), Musterbedingungen (MB) bzw. in ergänzenden Tarifbedingungen definiert und vertraglich vereinbart. Werden Tarife ausgewählt, die bestimmte Leistungsbestandteile nicht umfassen, so kann hierfür im Leistungsfall von der privaten Krankenversicherung keine Erstattung verlangt werden. Personen mit Beihilfeanspruch sollten berücksichtigen, dass die Beihilfe je nach Dienstherr bestimmte Leistungen nicht oder nur eingeschränkt übernimmt. Damit zwischen den Beihilfeleistungen und den Versicherungsleistungen keine Kostenlücke zu den tatsächlichen Behandlungskosten verbleibt, empfiehlt es sich für Beihilfeempfänger, einen Beihilfe-Ergänzungstarif abzuschließen.
In der Praxis sehr wichtig, jedoch für PKV-Interessenten vorab nur schwer vorhersehbar ist der tatsächliche Umgang eines Versicherers mit Leistungsfällen - auch Leistungsverhalten genannt. Die Bandbereite reicht von Versicherern, die sich im Leistungsfall eher restriktiv verhalten, teilweise Erstattung zunächst ablehnen bzw. nur Teilbeträge zahlen bis hin zu solchen, die Rechnungen auch in Grenzfällen üblicherweise kulant, unbürokratisch und zuverlässig erstatten. Etwas Ähnliches gilt auch für die Servicequalität eines Krankenversicherers: Wie ist es um die Erreichbarkeit bestellt? Wie schnell und hilfreich werden Anfragen beantwortet bzw. Vorgänge bearbeitet? Welche Kommunikationswege werden angeboten? Können Rechnungen einfach über eine App abfotografiert und eingereicht werden? Um sich zu diesen und weiteren Leistungsmerkmalen vorab einen Überblick zu verschaffen, können Rezensionen zu dem jeweiligen Anbieter hilfreich sein. Eine sehr gute Informationsquelle ist außerdem ein spezialisierter Makler mit langjähriger Praxiserfahrung.
Die Beitragshöhe wird im Wesentlichen bestimmt durch den gewählten Versicherer und Tarif sowie durch dein Alter und deinen Gesundheitszustand bei Vertragsabschluss. Tendenziell gilt: Je geringer der Leistungsumfang, je geringer dein Eintrittsalter und je besser dein Gesundheitszustand bei Vertragsabschluss ist, desto niedriger fällt dein anfänglicher PKV-Beitrag aus. Da im Leistungsfall grundsätzlich nur Mittel erstattet werden können, die das Versicherungskollektiv durch Beiträge einzahlt, besteht eine gewisse Abhängigkeit zwischen Beitragshöhe und Leistungsniveau des Tarifs bzw. Leistungsverhalten des Versicherers. Ein günstiger Tarif wird daher in aller Regel bei ähnliche guten Leistungsverhalten des Versicherers nicht nachhaltig das Absicherungsniveau eines Premiumtarifs bieten können. Die Tarifauswahl ist somit ein Abwägen zwischen Preis und Leistung: Langfristig bekommt man, wofür man zahlt. Ein Vergleich lohnt sich, um gute Angebote zu identifizieren. Beamtenanwärter bzw. Referendare (Beamte auf Widerruf) können von deutlich vergünstigten Ausbildungstarifen profitieren. Außerdem lässt sich durch die Vereinbarung einer Selbstbeteiligungen die Höhe des Beitrags auf Wunsch weiter reduzieren.
Betrachtet man die Beitragsentwicklung im Zeitablauf, so lassen sich Tarife unterscheiden, deren Beitrag in der Vergangenheit häufiger oder seltener angepasst wurde. Dies wird als Beitragsstabilität bezeichnet. Wie beitragsstabil ein Tarif ist, hängt von zahlreichen Faktoren ab und kann sich aufgrund der häufig langen Vertragslaufzeit einer PKV gerade im Alter finanziell deutlich bemerkbar machen. Beitragsanpassungen werden prinzipiell vorgenommen, wenn die eingezahlten Beiträge eines Versichertenkollektivs nicht ausreichen, um die gegenwärtigen bzw. die prognostizierten Leistungsausgaben zu refinanzieren. Wer seinen PKV-Beitrag im Alter reduzieren möchte, kann dazu bereits in jüngeren Jahren einen Beitragsentlastungstarifbaustein in den Vertrag einschließen. Hierdurch wird ein zusätzliches Sparguthaben gebildet, aus dem die höheren Leistungsausgaben in späteren Jahren gegenfinanziert werden, wodurch der künftig zu zahlende Beitrag geringer ausfällt.
Eine private Krankenversicherung begleitet dich im Idealfall dein Leben lang und hat daher in der Regel langfristige Auswirkungen auf deine Gesundheitsversorgung und deine Finanzen. Je länger eine PKV bereits besteht, desto nachteiliger kann ein späterer Wechsel aufgrund bereits gebildeter Alterungsrückstellungen oder zwischenzeitlich entstandener Vorerkrankungen sein. Die Auswahl des passenden PKV-Versicherers und des besten Tarifs sollte daher sorgfältig erfolgen. Aufgrund der zahlreichen, unterschiedlichen Tarife und Tarifbausteine wird die Beratung durch einen neutralen Versicherungsmakler empfohlen, der alle am Markt verfügbaren Angebote objektiv und transparent vergleichen kann. Dieser wertvolle Service verursacht dir grundsätzlich keinerlei Zusatzkosten.
Der wichtigste Tipp für das Vergleichen und die Auswahl einer Krankenversicherung ist: Den einen besten PKV-Tarif gibt es nicht - genau so wenig wie das beste T-Shirt, das beste Auto oder der beste Urlaub existiert. Ein All-inclusive-Urlaub am Meer mit tollem Strand mag großartig sein; für Reisende, die gerne Aktivurlaub in den Bergen machen, wäre es jedoch die falsche Wahl. Ein zweisitziges Cabrio hat zweifellos seinen Charme; für einen Skiurlaub mit der Familie ist es jedoch nicht ideal geeignet. Das Lieblingsshirt eines Bekannten muss nicht unbedingt den eigenen Modegeschmack treffen und selbst wenn es einem gefällt, würde man es sich vermutlich nicht zwingend in derselben Größe kaufen.
Die private Krankenversicherung bietet den großen Vorteil, dass sie sich an die persönlichen Anforderungen des Krankenversicherten anpassen lässt und dessen spezifische Situation berücksichtigt. Bei dem Vergleich und der Auswahl kommt es daher in erster Linie auf die Passung zum Versicherten an. PKV-Tests, beispielsweise von der Stiftung Warentest, von Focus Money oder von Franke und Bornberg (map-report), können sicher allgemeine Anhaltspunkte zu Versicherungsgesellschaften bzw. zu ihren Tarifen geben. Ähnliches gilt für Empfehlungen von Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten, sofern diese nicht selbst beruflich einen echten Überblick über den PKV-Markt haben. Für die Auswahl des bestgeeigneten Anbieters und PKV-Tarifs empfiehlt sich ein Berater mit einer Spezialisierung auf öffentlich Bedienstete, einem aktuellen Marktüberblick und professionellen PKV-Rechnern sowie eine sorgfältige Bestandsaufnahme. Dabei gilt es insbesondere auch Folgendes zu berücksichtigen:
Die private Krankenversicherung basiert auf dem Äquivalenzprinzip: Dementsprechend richtet sich der Beitrag eines Krankenversicherten nach dessen persönlichen Risikofaktoren bei Vertragsabschluss und dem gewählten Versicherungsschutz. Zu den Risikofaktoren zählen das Eintrittsalter und der anfängliche Gesundheitszustand. Zur Ermittlung des Gesundheitszustands sind bei Antragstellung einige Gesundheitsfragen zu beantworten. Je nach ihrer Art sind Behandlungen bzw. Diagnosen bis zu zehn Jahre rückwirkend anzugeben. Wie Versicherer dieselben Diagnosen aktuariell bewerten, kann sich in der Praxis deutlich unterscheiden. Insbesondere dann, wenn angabepflichtige Behandlungen bzw. Vorerkrankungen vorliegen, empfiehlt es sich daher ganz besonders, einen spezialisierten Versicherungsmakler hinzuzuziehen. Dieser kann bei in Frage kommenden Gesellschaften sogenannte anonyme Risikovoranfragen stellen und erhält daraufhin von Versicherern vorab die Information, zu welchen Konditionen die jeweilige Versicherungsgesellschaft eine Aufnahme in die Krankenversicherung anbietet. Für die Risikobewertung nicht erforderliche persönliche Daten, wie beispielsweise der Name des Interessenten, werden dabei nicht übermittelt. Reine Online-Rechner können dies in der Regel nicht leisten.
Außerdem ist es in der Regel ratsam, sich bereits bei Vertragsabschluss für eine langfristig sinnvolle Versicherung zu entscheiden, da bei nachträglichen Vertragsänderungswünschen eine erneute Gesundheitsprüfung erforderlich sein kann. Liegen Diagnosen vor, die eine Aufnahme in die private Krankenversicherung eigentlich unmöglich machen, können Beamte bei bestimmten Anbietern einmalig die sogenannte Öffnungsaktion der privaten Krankenversicherung nutzen (nähere Informationen dazu bietet der PKV-Verband). Da hierbei einige Fallstricke lauern, empfiehlt es sich, hierzu frühzeitig einen versierten Berater zu konsultieren. Eine möglichst frühe private Absicherung kann finanziell aus mehreren Gründen sinnvoll sein, da so neben einer häufig noch weniger umfangreichen Gesundheitshistorie auch von einem geringeren Eintrittsalter profitiert werden kann.
Für beihilfeberechtigte Beamte und Beamtenanwärter bzw. Referendare ist die private Absicherung insbesondere im Preis-Leistungs-Vergleich üblicherweise vorteilhaft gegenüber der Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenkasse. Etwas Gegenteiliges kann beispielsweise gelten, wenn die Besoldung des Versicherungsnehmers dauerhaft sehr gering sein wird, wenn zahlreiche Familienangehörige gemäß § 10 SGB V im Rahmen der Familienversicherung kostenlos mitversichert werden sollen, wenn gravierende Vorerkrankungen bestehen oder wenn bereits ein hohes Eintrittsalter erreicht ist. Unter diesen Voraussetzungen kann die Absicherung in einer gesetzlichen Krankenkasse auch für Beihilfeempfänger die vorteilhaftere Lösung sein.
So groß wie die Bandbreite der PKV-Leistungen, so groß ist auch das Preisspektrum: Je nach eigener Ausgangssituation (siehe oben) beginnen Monatsbeiträge für eine günstige Beamten-PKV bereits ab 141 Euro. Premiumtarife werden ab 184 Euro pro Monat angeboten. Günstige Ausbildungstarife für Beamtenanwärter bzw. Referendare im Vorbereitungsdienst (Beamte auf Widerruf) sind schon ab 57 Euro monatlich verfügbar. Toptarife für Anwärter kosten pro Monat oft nur rund 10 Euro mehr. Ursächlich für die deutlich geringeren Versicherungsprämien für Anwärter ist, dass in diesen Tarifen gemäß § 146 Abs. 3 VAG in Verbindung mit § 195 Abs. 2 VVG keine Alterungsrückstellungen im Sinne des § 341f Abs. 3 HGB gebildet werden müssen. Junge Beamte können zunächst ebenfalls von günstigeren Beiträgen profitieren, da der gesetzliche Zuschlag gemäß § 149 VAG grundsätzlich erst ab dem Kalenderjahr, das auf die Vollendung des 21. Lebensjahres des Krankenversicherten folgt, verbindlich erhoben werden muss.
Durch die Vereinbarung eines Selbstbehalts lässt sich der Monatsbeitrag nicht selten um bis zu 20% reduzieren. Je nach Anbieter und Tarif sind Zusatzleistungen bereits inkludiert oder lassen sich als ergänzende Tarifbausteine für teils sehr geringe Aufschläge hinzuwählen. So kann zum Beispiel eine Auslandsreisekrankenversicherung schon für unter einem Euro pro Monat hinzugewählt werden. Auch die Unterbringung im Einbettzimmer bei stationärer Behandlung ist in Anwärtertarifen teilweise für weniger als einen Euro monatlich erhältlich. Insgesamt kann die Preisgestaltung für die einzelne Bausteinen je nach Anbieter und Tarif recht unterschiedlich ausfallen. Ein umfassender, professioneller Vergleich kann daher sehr lohnend sein.
Der Versicherungsbeitrag setzt sich grundsätzlich zusammen aus einem Risikoanteil, einem Kostenanteil und einem Sparanteil. Aufgrund der Komplexität der Beitragsberechnung sowie der Vielzahl der Tarifbausteine und Wahlmöglichkeiten lassen sich durch eine versierte Beratung unter Verwendung professioneller Vergleichs-Rechner nicht selten einige hundert Euro pro Jahr einsparen. Werden bestimmte Versicherungsleistungen innerhalb eines vordefinierten Zeitraums nicht beansprucht, erstatten einige PKV-Anbieter je nach Tarif außerdem einen gewissen Teil der gezahlten Beiträge zurück. Welche Versicherungsleistungen ohne den Selbstbehalt bzw. ohne Auswirkung auf die Beitragsrückerstattung genutzt werden können, ist in unseren Beratungen daher eine häufig gestellte Frage.
Dem Dienstherr obliegt eine gesetzliche Fürsorgepflicht gegenüber seinen Bediensteten und Beamtenanwärtern bzw. Referendaren. Verfassungsrechtlich ergibt sie sich aus dem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis der Angehörigen des öD gemäß Artikel 33 Abs. 4 GG. Dessen Konkretisierung folgt beispielsweise auf Bundesebene aus § 78 BBG, wonach der Dienstherr im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses für das Wohl seiner Bediensteten und ihrer Familien, auch für die Zeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, zu sorgen hat. Ähnliche Regelungen enthalten auch die Landesbeamtengesetze.
Als eigenständige beamtenrechtliche Krankenfürsorge ist die Beihilfe ein wesentlicher Bestandteil dieser Fürsorgepflicht. Dabei verpflichtet sich der Dienstherr seinen Bediensteten, einen Teil der ihnen durch Krankheit, Pflegebedarf bzw. Geburt sowie für die Früherkennung von Krankheiten und Schutzimpfungen entstehenden Kosten zu erstatten. Die Leistungen dieser Individualbeihilfe erfolgen - analog der privaten Krankenversicherung - als Kostenerstattung.
Beihilfeempfänger müssen prinzipiell nur den nach Abzug der Beihilfeleistungen verbleibenden Anteil ihrer Krankheitskosten absichern. Dies macht die PKV für Personen mit Beihilfeanspruch im Vergleich mit einer privaten Krankheitskostenabsicherung für Angestellte grundsätzlich erhebliche günstiger, da die Versicherung nur das restliche Kostenrisiko als versicherten Prozentsatz abdecken muss. Daher wird die beihilfekonforme Krankheitskostenversicherung auch als Restkostenversicherung bezeichnet.
Das Beihilferecht ist nicht bundeseinheitlich geregelt: Für Bundesbeamte finden sich allgemeine Regelungen zur Beihilfe im Bundesbeamtengesetz (u. a. § 80 BBG), die durch die Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) und die allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Bundesbeihilfeverordnung (BBhVVwV) konkretisiert werden. In der Regel ähnlich strukturiert enthalten üblicherweise die Landesbeamtengesetze - teilweise unter Bezugnahme auf das Bundesbeamtengesetz - grundlegende Regelungen zur Beihilfe für Landesbeamte, die teilweise in länderspezifischen Landesbeihilfeverordnungen und ggf. ergänzenden Verwaltungsvorschriften der Bundesländer weiter detailliert werden:
Landesbeamtengesetz Baden-Württemberg (u. a. § 78 LBG BW) in Verbindung mit der Beihilfeverordnung Baden-Württemberg (BVO BW) und der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur Beihilfeverordnung (VwVBVO BW)
Bayerisches Beamtengesetz (u. a. Art. 96 BayBG) in Verbindung mit der Bayerischen Beihilfeverordnung (BayBhV) und der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der Bayerischen Beihilfeverordnung (BayBhVBek)
Landesbeamtengesetz Berlin (u. a. § 76 LBG BE) in Verbindung mit der Landesbeihilfeverordnung Berlin (LBhVO BE) und den Ausführungsvorschriften zur Landesbeihilfeverordnung Berlin (AV LBhVO BE)
Beamtengesetz für das Land Brandenburg (u. a. § 62 LBG BB) in Verbindung mit den Regelungen für Bedienstete und Versorgungsempfänger des Bundes
Bremisches Beamtengesetz (u. a. § 80 BremBG) in Verbindung mit der Bremischen Beihilfeverordnung (BremBVO)
Hamburgisches Beamtengesetz (u. a. § 80 HmbBG) in Verbindung mit der Hamburgischen Beihilfeverordnung (HmbBeihVO)
Hessisches Beamtengesetz (u. a. § 80 HBG) in Verbindung mit der Hessischen Beihilfenverordnung (HBeihVO) und den Verwaltungsvorschriften zur Hessischen Beihilfenverordnung (VV HBeihVO)
Beamtengesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (u. a. § 80 LBG M-V) in Verbindung mit den Regelungen für Bedienstete und Versorgungsempfänger des Bundes
Niedersächsisches Beamtengesetz (u. a. § 80 NBG) in Verbindung mit der Niedersächsischen Beihilfeverordnung (NBhVO)
Landesbeamtengesetz Nordrhein-Westfalen (u. a. § 75 LBG NRW) in Verbindung mit der Beihilfeverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (BVO NRW) und den Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der Verordnung über die Gewährung von Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen (VVzBVO NRW)
Landesbeamtengesetz Rheinland-Pfalz (u. a. § 66 LBG RP) in Verbindung mit der Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz (BVO RP)
Saarländisches Beamtengesetz (u. a. § 67 SBG) in Verbindung mit der Saarländischen Beihilfeverordnung (BhVO SL)
Sächsisches Beamtengesetz (u. a. § 80 SächsBG) in Verbindung mit der Sächsische Beihilfeverordnung (SächsBhVO) und der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zum Vollzug der Sächsischen Beihilfeverordnung (VwV-SächsBhVO)
Besoldungs- und Versorgungsrechtsergänzungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (u. a. § 3 BesVersEG LSA) in Verbindung mit den Regelungen für Bedienstete und Versorgungsempfänger des Bundes
Landesbeamtengesetz Schleswig-Holstein (u. a. § 80 LBG SH) in Verbindung mit der Beihilfeverordnung Schleswig-Holstein (BhVO SH)
Thüringer Beamtengesetz (u. a. § 72 ThürBG) in Verbindung mit der Thüringer Beihilfeverordnung (ThürBhV)
Diese spezifischen Vorgaben des Bundes bzw. der Länder enthalten teils unterschiedliche Regelungen zur Beihilfe. Abweichungen bestehen unter anderem im Hinblick auf Zuzahlungen und Wahlleistungen bei stationärer Behandlung, Zahnersatz, Kieferorthopädie, Arzneimittel, Hilfsmittel, Sehhilfen, Kur- und Rehaleistungen, Pflege, Selbstbehalte, Kostendämpfungspauschalen, Belastungsgrenzen, Antragsgrenzen bzw. Mindestbetragsgrenzen sowie hinsichtlich der Gewährung pauschaler Beihilfe.
Ein weiterer ganz wesentlicher Unterschied besteht in dem Anteil der Krankheitskosten, der als Beihilfeleistung übernommen wird. Dieser wird auch als Beihilfebemessungssatz bezeichnet. In der Regel deckt die Beihilfe je nach Beihilferecht und persönlicher Situation des Beihilfeberechtigten zwischen 50 Prozent und 90 Prozent der tatsächlich entstandenen Krankheitskosten ab. Die Details hierzu regeln die vorgenannten Rechtsgrundlagen. In ihnen ist außerdem festgelegt, welche Personen einen Beihilfeanspruch haben und welche Aufwendungen beihilfefähig sind. Sind bestimmte Aufwendungen gemäß der geltenden Beihilferegelungen nicht beihilfefähig, kann ein Beihilfeergänzungstarif zur Abdeckung des Kostenrisikos abgeschlossen werden.
Anders als Angestellte können Beihilfeempfänger aufgrund ihres Anspruchs auf individuelle Beihilfe für gewöhnlich keine Beteiligung ihres Dienstherrn an ihrem Krankenversicherungsbeitrag verlangen. Bestimmte Bundesländer - unter anderem Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Thüringen - bieten jedoch ein Wahlrecht: Es kann entweder die Individualbeihilfe - also die Übernahme eines Teils der tatsächlichen Krankheitskosten - oder eine pauschale Beihilfe - also eine Beteiligung des Dienstherrn am Krankenversicherungsbeitrag - beansprucht werden. Die Höhe der Pauschalbeihilfe ist dabei unabhängig von den tatsächlichen Krankheitskosten des Beihilfeempfängers und beträgt grundsätzlich die Hälfte des nachgewiesenen, tatsächlichen Krankenversicherungsbeitrags. Sie wird monatlich zusammen mit den Bezügen gezahlt.
Falls du überlegst, die pauschale Beihilfe zu beanspruchen, solltest du zuvor insbesondere die folgenden Punkte berücksichtigen:
Da die Kriterien für die Entscheidung zwischen der Individualbeihilfe und der Pauschalbeihilfe häufig vielfältig und komplex sind und eine vorausschauende Abwägung aller relevanten Aspekte erfordert, empfiehlt es sich, hierzu vorab einen auf Beamte spezialisierten Versicherungsmakler zu konsultieren.
Grundsätzlich kann unterschieden werden zwischen Personen mit unmittelbarem Anrecht auf Beihilfe, den sogenannten Beihilfeberechtigten, und Personen mit mittelbarem Beihilfeanspruch, den sogenannten berücksichtigungsfähigen Angehörigen. Beihilfeberechtigte sind Beamte, Richter, Versorgungsempfänger sowie deren Witwen und Waisen bzw. Halbwaisen. Zu den berücksichtigungsfähigen Angehörigen zählen - abhängig von deren Einkommen - Eheleute und eingetragene Lebenspartner von Beihilfeberechtigten sowie ihre im Familienzuschlag berücksichtigten bzw. berücksichtigungsfähigen Kinder.
Die Einkommensgrenzen und Bemessungsgrundlagen, bis zu denen Eheleute und eingetragene Lebenspartner berücksichtigungsfähig im Sinne der Beihilfe sind, unterscheiden sich je nach geltendem Beihilferecht. Grundlage für die Beurteilung bildet der im Einkommensteuerbescheid für das relevante Jahr ausgewiesene Gesamtbetrag der Einkünfte (GdE) gemäß § 2 Abs. 3 EStG in Verbindung mit § 2 Abs. 5a EStG, zuzüglich vergleichbarer ausländischer Einkünfte sowie teilweise zuzüglich bestimmter Renten. Anfang 2024 galten in den einzelnen Beihilferegimen folgende Werte:
§ 6 Abs. 2 BBhV: GdE im vorletzten Jahr maximal 20.878 € (dynamische Anpassung auf Basis des Rentenwerts West)
§ 78 Abs. 1a LBG BW: GdE im letzten oder vorletzten Jahr maximal 20.000 €
Art. 96 Abs. 1 BayBG: GdE im vorletzten Jahr maximal 20.878 € (dynamische Anpassung auf Basis des Rentenwerts West)
§ 4 Abs. 1 LBhVO BE: GdE im vorletzten Jahr maximal 20.000 €
§ 62 Abs. 2 LBG BB: GdE im vorletzten Jahr maximal 20.000 €
§ 80 Abs. 2 BremBG, § 1b Abs. 3 BremBVO: GdE im letzten Jahr maximal 12.000 €
§ 80 Abs. 11 Nr. 1c HmbBG, § 2 Abs. 5 HmbBeihVO: GdE im letzten Jahr maximal 20.000 €
§ 80 Abs. 1 S. 2 HBG: GdE im vorletzten Jahr maximal 23.208 € (das Zweifache des Grundfreibetrags gemäß § 32a Abs. 1 EStG)
§ 6 Abs. 2 BBhV: GdE im vorletzten Jahr maximal 20.878 € (dynamische Anpassung auf Basis des Rentenwerts West)
§ 80 Abs. 3 S. 2 NBG: GdE im vorletzten Jahr maximal 20.000 €
§ 75 Abs. 2 LBG NRW, § 2 Abs. 1 Nr. 1b BVO NRW: GdE im letzten Jahr maximal 21.995 € (dynamische Anpassung auf Basis des Rentenwerts West)
§ 66 Abs. 2 LBG RP: bei Heirat nach dem 31.12.2011 GdE im vorletzten Jahr maximal 17.000 €, bei Heirat vor dem 01.01.2012 und Begründung des Beihilfeanspruchs nach dem 01.01.2012 GdE im vorletzten Jahr maximal 17.000 €, andernfalls maximal 20.450 €
§ 4 Abs. 7 BhVO SL: GdE im vorletzten Jahr maximal 17.595 € (dynamische Anpassung auf Basis des Rentenwerts West)
§ 80 Abs. 4 SächsBG, § 4 Abs. 2 SächsBhVO: GdE in den letzten 3 Jahren im Durchschnitt maximal 18.504 € (dynamische Anpassung auf Basis der Grundgehaltssätze gemäß § 19 SächsBesG)
§ 6 Abs. 2 BBhV: GdE im vorletzten Jahr maximal 20.878 € (dynamische Anpassung auf Basis des Rentenwerts West)
§ 80 Abs. 6 LBG SH: GdE im vorletzten Jahr maximal 20.000 €
§ 72 Abs. 2 ThürBG, § 3 Abs. 1 Nr. 1 ThürBhV: GdE im vorletzten Jahr maximal 18.000 €
Der Nachweis erfolgt in der Regel durch Vorlage einer Kopie des Steuerbescheids bzw. Vorlage einer Nichtveranlagungsbescheinigung des Finanzamts. Nicht im deutschen Steuerbescheid ausgewiesene Einkünfte sind durch geeignete Unterlagen nachzuweisen.
Sind die Einkünfte im Kalenderjahr der Antragstellung geringer als im relevanten Betrachtungszeitraum und wird die Einkommensgrenze im laufenden Jahr voraussichtlich nicht überschritten, können Ehepartner bzw. Lebenspartner - je nach geltender Beihilfeordnung - gegebenenfalls bereits unter Vorbehalt berücksichtigungsfähig im Sinne des Beihilferechts sein. Die Beihilfefestsetzungen werden in diesem Fall nach Vorlage des Steuerbescheids überprüft. Einzelne Beihilferegime sehen außerdem für besondere Härtefälle Ausnahmeregelungen zu den vorgenannten Anforderungen vor.
Die Höhe des Bemessungssatzes - also wie viel Prozent Beihilfe für Krankheitskosten erstattet werden - kann je nach Beihilferecht, der persönlichen Situation des Beihilfeberechtigten bzw. der Art des berücksichtigungsfähigen Angehörigen variieren. Beihilfeberechtige erhalten im Regelfall einen Bemessungssatzes in Höhe von 50%. Haben sie in ihrem Familienzuschlag berücksichtigte Kinder (in der Regel sind mindestens zwei Kinder erforderlich) sieht das Beihilferecht des Bundes und vieler Bundesländer eine Steigerung ihres Beihilfebemessungssatz auf 70% vor. Dieser Bemessungssatz gilt in vielen Beihilferegimen außerdem auch für berücksichtigungsfähige Eheleute und eingetragene Lebenspartner, für Versorgungsempfänger bzw. Pensionäre sowie teilweise für Bedienstete in Elternzeit. Für berücksichtigungsfähige Kinder sehen die meisten Beihilferegime einen Beihilfebemessungssatz von 80% vor. Von diesen im Beihilferecht üblichen Regelungen teils deutlich abweichende Bemessungsgrundlagen bzw. Bemessungssätze finden sich insbesondere im Beihilferecht der Bundesländer Bremen, Hessen, Sachsen und Schleswig-Holstein. So sieht das Beihilferecht in Sachsen und Schleswig-Holstein beispielsweise Beihilfesätze von bis zu 90% vor.
Je höher der Beihilfebemessungssatz, desto geringer ist der verbleibende Kostenanteil, der privat mithilfe einer privaten Krankenversicherung abzudecken ist. Entsprechend fallen die Monatsbeiträge der Krankenversicherung bei hohen Beihilfesätzen in aller Regel sehr günstig aus.
Wie hoch dein persönlicher Beitrag ist, ermitteln wir gerne kostenlos und unverbindlich für dich mithilfe unseres private Krankenversicherung-Rechners. Dabei können wir alle verfügbaren Tarife der am deutschen Markt aktiven Versicherungsgesellschaften für dich vergleichen - von Allianz, ARAG, Barmenia Krankenversicherung AG und DBV (u. a. BWE-U) über Debeka, DEVK, HUK-COBURG-Krankenversicherung AG, LVM (Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster) und Mecklenburgische bis hin zu Nürnberger, Provinzial, R+V, Signal Iduna und VRK (Versicherer im Raum der Kirchen) sowie zahlreiche weitere Anbieter. Komm hierzu einfach auf uns zu.
Neben der Beihilfe bildet die Heilfürsorge ein weiteres besonderes Krankensicherungssystem für den öD. Angeboten wird es in der Regel für Berufsgruppen, die bei ihrer beruflichen Tätigkeit für gewöhnlich besonderen Risiken ausgesetzt sind und somit im Kontext der Fürsorgepflicht besonderes Schutz benötigen. Ähnlich der Beihilfe bezeichnet die Heilfürsorge ein Anrecht des Berechtigten auf Übernahme von Gesundheitskosten bzw. Gesundheitsleistungen durch den Dienstherrn. Grundsätzlich werden dem Berechtigten Leistungen der Heilfürsorge mit einem angemessenen Betrag als Sachbezüge auf die Besoldung angerechnet. Die Höhe der Anrechnung regelt das jeweils geltende Heilfürsorge- bzw. Besoldungsrecht. Hiervon zu unterscheiden ist die sogenannte freie Heilfürsorge: Bei der freien Heilfürsorge wird dem Berechtigten das Anrecht auf Übernahme der Krankheitskosten unentgeltlich gewährt. Eine Sonderform der Heilfürsorge bildet die unentgeltliche truppenärztliche Versorgung (utV) für Soldaten der Bundeswehr gemäß § 69a BBesG in Verbindung mit § 16 WSG. Dabei erfolgt die Versorgung im Regelfall durch medizinische Einrichtungen der Bundeswehr.
Die Leistungen der Heilfürsorge schließen die Beihilfefähigkeit üblicherweise aus (siehe beispielsweise § 8 Abs. 1 Nr. 1 BBhV). Sie entsprechen in etwa dem Leistungsumfang gesetzlichen Krankenkassen. Diese Anlehnung an die gesetzliche Krankenversicherung gemäß SGB V findet sich beispielsweise in § 69a Abs. 3 S. 2 BBesG sowie in § 70 Abs. 2 S. 3 BBesG. Je nach geltendem Heilfürsorgerecht werden darüber hinaus vereinzelt ergänzende Sonderleistungen gewährt. Die Heilfürsorge ist insofern grundsätzlich als Basisversorgung zu verstehen. Eine vollständige Absicherung gegen alle finanziellen Folgen einer Erkrankung bietet sie in aller Regel nicht. Bei Zahnersatz übernimmt die Heilfürsorge zum Beispiel üblicherweise nur eine preisgünstige Regelversorgung bzw. zahlt Material- und Laborkosten nur zum Teil. Heilpraktikerleistungen sind - je nach Heilfürsorgerecht - vollständig ausgeschlossen. Außerdem sind teilweise Eigenanteile bzw. Kürzungen bei stationärer Behandlung vorgesehen. Eine ergänzende private Zusatzabsicherung zur Heilfürsorge kann daher sinnvoll sein.
Verpflichtend ist für Heilfürsorgeberechtigte der Abschluss einer Pflegeversicherung. Diese ist nicht Bestandteil der Heilfürsorge, jedoch gemäß § 1 Abs. 2 SGB XI in Verbindung mit § 23 SGV XI obligatorisch. Das Bestehen des Versicherungsschutzes haben Heilfürsorgeberechtigte vor dem Hintergrund des § 51 Abs. 2 SGB XI in der Regel innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Dienstantritt nachzuweisen. Eine solche Pflegeversicherung kann entweder freiwillig mit einer gesetzlichen Krankenkasse (soziale Pflegeversicherung) oder mit einer privaten Krankenversicherung (private Pflegepflichtversicherung) vereinbart werden. Der Leistungsumfang dieser Versicherung sind im SGB XI definiert und somit bei allen Anbietern in Deutschland weitestgehend einheitlich. Preislich können sich die Pflegeversicherungen der einzelnen Anbieter in gewissem Umfang unterscheiden. Einzelne private Krankenversicherer bieten außerdem spezielle Pflegepflichtversicherungstarife für Beamtenanwärter bzw. Referendare zu besonderen Konditionen an.
Ein ganz entscheidender Unterschied der Heilfürsorge gegenüber der Beihilfe besteht darin, dass der Heilfürsorgeanspruch zeitlich begrenzt ist - beispielsweise auf die aktive Dienstzeit des Heilfürsorgeberechtigten. Endet zum Beispiel die Ausbildung, des aktiven Dienstes, erfolgt eine Versetzung oder wird eine Dienstunfähigkeit festgestellt, kann damit das Anrecht auf Heilfürsorge entfallen. Eine häufige Frage ist, was in diesem Fall geschieht: Mit dem Wegfall ihres Heilfürsorgeanspruchs haben Berechtigte ein Anrecht auf Beihilfe. Für Heilfürsorgeberechtigte ist es daher extrem wichtig, sich für den Zeitpunkt des Wegfalls ihres Heilfürsorgeanspruchs frühzeitig die Möglichkeit zum Abschluss einer privaten Krankenversicherung zu sichern.
Insbesondere wenn das Anrecht auf Heilfürsorge erst in fortgeschrittenem Alter - beispielsweise mit dem Ende der aktiven Dienstzeit - oder aufgrund relevanter Erkrankungen - zu Beispiel mit Feststellung der Dienstunfähigkeit - entfällt, kann eine Aufnahme in die PKV ohne gute Vorbereitung nachteilig bis unmöglich sein. Daher ist es für Heilfürsorgeberechtigte sehr wichtig, so früh wie möglich eine Anwartschaftsversicherung (hierzu später mehr) abzuschießen.
Wenn du mehr zur Anwartschaftsversicherung und zu den verschiedenen Anbietern und Tarifen wissen möchtest, lass dich gerne von uns beraten.
Der Aufnahme in die private Krankenversicherung geht eine Prüfung der persönlichen Risikofaktoren voraus (siehe oben). Liegen bei Antragstellung bereits gravierende Vorerkrankungen vor oder sind relevante Diagnosen in der Patientenakte vermerkt, kann dies die Aufnahme in die PKV erschweren - in Form monetärer Risikozuschläge bzw. partieller Leistungsausschlüsse - oder sie sogar unmöglich machen. Dein individueller Gesundheitszustand ist daher von ganz entscheidender Bedeutung dafür, ob bzw. zu welchen Konditionen dir private Krankenversicherer eine Krankenversicherung anbieten.
Mithilfe einer Anwartschaftsversicherung kann der persönliche Gesundheitszustand zum Zeitpunkt des Abschlusses der Anwartschaftsversicherung bei der betreffenden Versicherungsgesellschaft für einen vordefinierten Krankenversicherungsschutz für die Zukunft "eingefroren" werden. Die Gesundheitsprüfung erfolgt insofern bereits vorab. Die Anwartschaft kann dann zu einem späteren Zeitpunkt ohne erneute Gesundheitsprüfung in eine private Krankenversicherung Beamte umgewandelt werden. Erkrankungen, die erstmalig während der Vertragslaufzeit der Anwartschaftsversicherung auftreten, sind damit für die spätere Umwandlung in eine PKV unerheblich. Eine Anwartschaftsversicherung kann vor, nach oder während einer Unterberechnung der Absicherung in einer regulären PKV bestehen.
Unterschieden wird zwischen kleinen Anwartschaften und großen Anwartschaften: Für beide Varianten gilt, dass sie üblicherweise - vor der Umwandlung in eine Krankenversicherung Beamte - keine Krankenversicherungsleistungen beinhalten. Es wird daher auch von einem ruhenden Vertragsverhältnis gesprochen. Anwartschaftsversicherungen ersetzen daher nicht die obligatorische Krankenversicherung. Sie können jedoch eine nochmalige Gesundheitsprüfung bei ihrer Umwandlung in eine private Krankenversicherung ersparen. Wird eine Anwartschaftsversicherung genutzt um eine vorübergehende Unterbrechung des Krankenversicherungsschutzes zu überbrücken, so bleiben außerdem zuvor bereits gebildete Alterungsrückstellungen durch die Anwartschaft erhalten. Die Besonderheit einer großen Anwartschaft besteht darin, dass auch während des Anwartschaftszeitraums weitere Alterungsrückstellungen gebildet werden. Bei der Umstellung einer großen Anwartschaft in eine PKV wird daher das ursprüngliche Eintrittsalter des Versicherten einschließlich seiner Anwartschaftszeit zugrunde gelegt, woraus ein günstigerer Monatsbeitrag zur PKV resultiert. Um sich diesen Vorteil zu sichern, geht die große Anwartschaft mit einem höheren Monatsbeitrag einher. Je nach Versicherungsgesellschaft sind kleine Anwartschaften für Bedienstete teileweise schon für weniger als ein Euro pro Monat erhältlich. Einzelne Versicherungsgesellschaften bieten kleine Anwartschaftsversicherungen in Verbindung mit einer privaten Pflegepflichtversicherung für Heilfürsorgeberechtigte zu besonders vergünstigten Konditionen an. Der Beitrag für eine große Anwartschaft kann sich je nach Anbieter und persönlicher Ausgangssituation spürbar unterscheiden und beginnt in der Regel im mittleren zweistelligen Eurobereich.
Neben der Anwartschaftsversicherung bieten manche Gesellschaften auch sogenannte Optionstarife an. Diese beinhalten das Recht, bei Eintritt vordefinierter Ereignisse ohne erneute Gesundheitsprüfung bei der betreffenden Versicherungsgesellschaft eine Krankenversicherung abschließen zu können. Eine Verpflichtung des Kunden zum Abschluss einer Krankenversicherung ist damit - wie bei der Anwartschaft - nicht verbunden. Im Gegensatz zur Anwartschaftsversicherung ist ein Optionstarif bei Vertragsbeginn nicht auf einen bestimmten Krankenversicherungstarif festgelegt. Vielmehr wird erst bei Ausübung der Option innerhalb des im Optionstarif verfügbaren Tarifspektrums entschieden, welche Tarife gewünscht sind. Optionstarife bieten somit üblicherweise eine größere Tarifauswahl als Anwartschaftsversicherungen. In beiden Fällen ist die Auswahl bei Umwandlung bzw. Ausübung jedoch auf die Versicherungsgesellschaft beschränkt, bei welcher der Optionstarif bzw. die Anwartschaftsversicherung besteht. Daher sollte bereits bei ihrem Abschluss darauf geachtet werden, dass der betreffende Anbieter auch die beste private Krankenversicherung für die persönlichen Absicherungswünsche anbietet. Durch Anwartschaftsversicherungen bzw. Optionstarife kann sich eine mögliche spätere Absicherung in der privaten Krankenversicherung sowohl deutlich einfacher als auch spürbar preisgünstiger gestalten. Da sich die am Markt verfügbaren Produkte in Preis und Leistungsumfang teils deutlich unterscheiden, empfiehlt sich ein fundierter, professioneller Vergleich. Gerne unterstützen wir dich dabei mit unseren professionellen Vergleichs-Rechnern, unserem Marktüberblick und unserer Expertise.
Die Dienstunfähigkeit ist auf Bundesebene in § 44 Abs. 1 BBG legaldefiniert: Demnach sind Beamte auf Lebenszeit (BaL) grundsätzlich in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie wegen ihres körperlichen Zustands oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten dauernd unfähig sind. Als dienstunfähig kann demnach auch angesehen werden, wer infolge von Erkrankung innerhalb von sechs Monaten mehr als drei Monate keinen Dienst getan hat, wenn keine Aussicht besteht, dass innerhalb weiterer sechs Monate die Dienstfähigkeit wieder voll hergestellt ist. Bestehen Zweifel bezüglich der Dienstunfähigkeit, ist der Bedienstete gemäß § 44 Abs. 6 BBG verpflichtet, sich nach Weisung der Behörde ärztlich untersuchen und - falls dies aus amtsärztlicher Sicht für erforderlich gehalten wird - auch beobachten zu lassen. Gemäß § 48 Abs. 1 BBG kann die zuständige Behörde die ärztliche Untersuchung nur einem Amtsarzt übertragen oder einem Arzt übertragen, der von der obersten Dienstbehörde oder einer berechtigten nachgeordneten Behörden als Gutachter zugelassen ist.
Das Verfahren bei Dienstunfähigkeit regelt § 47 BBG wie folgt: Hält der Dienstvorgesetzte den Bediensteten aufgrund eines ärztlichen Gutachtens über den Gesundheitszustand für dienstunfähig und ist eine anderweitige Verwendung nicht möglich oder liegen die Voraussetzungen für die begrenzte Dienstfähigkeit nicht vor, teilt er dem Betroffenen mit, dass die Versetzung in den Ruhestand beabsichtigt ist. Dabei sind die Gründe für die Versetzung in den Ruhestand anzugeben. Der Betroffene kann innerhalb eines Monats Einwendungen erheben. Danach entscheidet die für die Ernennung zuständige Behörde über die Versetzung in den Ruhestand mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Versetzungsverfügung ist dem Betroffenen schriftlich zuzustellen. Der Ruhestand beginnt mit dem Ende des Monats, in dem die Versetzung in den Ruhestand dem Betroffenen bekannt gegeben worden ist. Ab diesem Zeitpunkt wird die Besoldung einbehalten, die das Ruhegehalt übersteigt. Die Höhe des Ruhegehalts richtet sich in diesem Fall nach den erzielten ruhegehaltfähigen Dienstbezügen und der geleisteten ruhegehaltfähigen Dienstzeit, gegebenenfalls verringert um einen Versorgungsabschlag für den vorzeitigen Bezug des Ruhegehalts.
Zu beachten ist, dass der Eintritt in den Ruhestand gemäß § 50 BBG regelmäßig die Einhaltung einer versorgungsrechtliche Wartezeit voraussetzt. Für Landesbeamte findet sich in § 32 BeamtStG eine analoge Grundsatzregelung. Diese Wartezeit erfordert gemäß § 4 BeamtVG grundsätzlich das Ableisten einer ruhegehaltsfähigen Dienstzeit von mindestens fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der ersten Berufung in das Beamtenverhältnis. Für Landesbeamte enthält das Beamtenrecht der Bundesländer ähnliche Regelungen. Ist diese Wartezeit bei Eintritt der Dienstunfähigkeit nicht erfüllt, kann dies dazu führen, dass Bedienstete trotz vorliegender Dienstunfähigkeit kein Anrecht auf Ruhegehalt haben. Dies betrifft in der Praxis neben erst unlängst auf Lebenszeit verbeamteten Personen insbesondere Beamte auf Probe (BaP) und auf Widerruf (BaW). Ein Versorgungsanspruch besteht in diesem Fall regelmäßig nicht. Bedienstete, die aus dem Dienst entlassen werden, können in diesem Fall in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert werden, sodass prinzipiell ein Recht auf Erwerbsminderungsrente besteht.
Für BaP gilt hinsichtlich der Feststellung der Dienstunfähigkeit eine weitere Einschränkungen: Gemäß § 49 Absatz 1 BBG sind sie grundsätzlich nur in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie infolge von Krankheit, Verwundung oder sonstiger Beschädigung, die sie sich ohne grobes Verschulden bei Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen haben, dienstunfähig geworden sind. Tritt die Dienstunfähigkeit aufgrund einer anderen Ursache - beispielsweise eines Unfalls in der Freizeit ein - haben BaP möglicherweise ebenfalls kein Anrecht auf Ruhegehalt. Im Falle einer Dienstunfähigkeit aufgrund eines Dienstunfalls können Bedienstete für die Dauer ihrer Erwerbseinschränkung gemäß § 38 BeamtVG Anspruch auf einen Unterhaltsbeitrag haben. Dieser beträgt bei völliger Erwerbsunfähigkeit 66,67% der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge zum Zeitpunkt des Eintritts der Dienstunfähigkeit. Diese Regelung gilt auch für Bedienstete, die die versorgungsrechtliche Wartezeit noch nicht erfüllt haben.
Begrenzte Dienstfähigkeit - auch Teildienstfähigkeit bzw. Teildienstunfähigkeit genannt - liegt gemäß § 45 BBG vor, wenn der Bedienstete unter Beibehaltung des übertragenen Amtes die Dienstpflichten noch während mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit erfüllen kann. In diesem Fall ist die Arbeitszeit entsprechend der begrenzten Dienstfähigkeit zu verkürzen. Analoge Reglungen für Landesbeamte enthält § 27 BeamtStG. Die Bezüge werden unter diesen Voraussetzungen gemäß § 6a BBesG in Verbindung mit § 6 Abs. 1 BBesG grundsätzlich im gleichen Verhältnis reduziert wie die Arbeitszeit und gegebenenfalls ergänzt um einen nicht ruhegehaltfähigen Zuschlag.
Jede der vorgenannten Situationen geht nicht nur mit nennenswerten gesundheitlichen Beeinträchtigungen einher, sondern außerdem auch mit teils gravierenden unmittelbaren bzw. zukünftigen finanziellen Einbußen. Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) wurden 2021 17 % aller Neupensionierten wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt. Das Risiko einer Dienstunfähigkeit ist somit nicht nur hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen relevant, sondern auch statistisch real. Eine Dienstunfähigkeitsversicherung (DU) schützt Bedienstete vor den finanziellen Folgen einer Dienstunfähigkeit. Im Leistungsfall erhält der Versicherte die vereinbarte Dienstunfähigkeitsrente und wird gleichzeigt von den Beitragszahlungen für die Dienstunfähigkeitsversicherung befreit. Insbesondere für Beamtenanwärter bzw. Referendare als auch für anderweitige Bedienstete, die die versorgungsrechtliche Wartezeit noch nicht erfüllt haben, kann diese Absicherung sehr wertvoll sein.
Wünscht du dir hierzu weitere Informationen oder eine individuelle Beratung? Dann komm gerne auf uns zu.
Gemäß § 839 BGB hat ein Bediensteter, der vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht verletzt, dem Dritten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. In Verbindung mit dem Amtshaftungsanspruch gemäß Art. 34 GG wird diese persönliche Beamtenhaftung grundsätzlich auf den Dienstherrn übergeleitet, sodass dieser im Außenverhältnis - also dem Dritten gegenüber - anstelle seines Bediensteten haftet. Art. 34 S. 2 GG ermöglicht in diesem Zusammenhang jedoch bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit im Innenverhältnis den Rückgriff auf den Bediensteten selbst. Konkretisiert wird diese persönliche und prinzipiell unbegrenzte Regresshaftung auf Bundesebene durch § 75 BBG: Demnach haben Bedienstete, die bei ihrer Aufgabenwahrnehmung vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihnen obliegenden Pflichten verletzen, ihrem Dienstherrn den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Haben zwei oder mehr Bedienstete einen solchen Schaden gemeinsam verursacht, haften sie gesamtschuldnerisch. Eine entsprechende vermögensrechtliche Haftung im Innenverhältnis für Landesbeamte regelt § 48 BeamtStG.
Für die persönliche Regresspflicht ist kein vorsätzliches Handeln erforderlich - es genügt bereits grobe Fahrlässigkeit. Entsprechende Schadenersatzansprüche sind ihrer Höhe nach grundsätzlich unbegrenzt und können somit - vor allem bei Personenschäden - in der Praxis erhebliche Beträge erreichen.
Analog einer Privathaftpflichtversicherung für den außerdienstlichen Bereich, bietet eine Diensthaftpflichtversicherung - auch Amtshaftpflichtversicherung genannt - Schutz gegen Schadensersatzansprüchen, die aus der Ausübung deiner dienstlichen Tätigkeit entstehen können. Der in aller Regel sehr geringe Beitrag für eine solche Diensthaftpflichtversicherung richtet sich üblicherweise nach der Art der dienstlichen Tätigkeit, den eingeschlossenen Leistungen, der Höhe der Absicherung und einer etwaigen Selbstbeteiligung. Im günstigsten Fall ist eine Diensthaftpflichtversicherung bereits für unter 10 Euro pro Jahr erhältlich. Dabei kann im Rahmen einer Schlüsselversicherung auf Wunsch auch der Verlust fremder Schlüssel abgesichert werden. Gerade wenn dir Dienstschlüssel anvertraut wurden, die Teil einer zentralen Schließanlage sind, kann dies eine sehr sinnvolle Ergänzung sein. Da eine Diensthaftpflichtversicherung schon für einen geringen Jahresbeitrag erhältlich ist und potenziell hohe Schadenersatzansprüche absichert, empfiehlt sich diese Absicherung für Bedienstete in aller Regel.
Seit der Gründung von OPTINVEST im Jahr 2012 liegt der Fokus des Unternehmens auf der Beratung von Beamten zu Versicherungen, Geldanlagen und Finanzierungen. Der Unternehmensgründer Mirko Feller, der selbst Berufsschullehramt studiert hat und einige Jahre als Lehrkraft tätig war, sowie die Mitarbeiter von OPTINVEST verfügen insgesamt über mehr als 50 Jahre Berufspraxis in verschieden Funktionen des öD und kennen daher die besten Versicherungs- und Finanzlösungen für Menschen im öffentlichen Bereich aus eigener Erfahrung. OPTINVEST berät mehrere tausend Kundinnen und Kunden mit dem festen Anspruch, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten und stets die besten Lösungen am Markt nach den jeweils spezifischen Kundenwünschen zu finden. Besonders stolz sind wir dabei auf das großartige Feedback, dass uns unsere Kundinnen und Kunden zu unserer Arbeit geben. Wenn auch du von unserer Beratung profitieren möchtest, danken wir dir schon jetzt ganz herzlich für dein Vertrauen und sichern dir zu, dass wir auch für dich unser Allerbestes geben werden. Wir freuen uns auf dich!


Projektmanagerin
Social Media Managerin


Projektmanagerin
Spezialistin HR


Spezialistin für Kundenservice


Leiter Onlinemarketing


Fachconsultant Humanmedizin


Finanz- & Versicherungsspezialistin
Spezialistin für Sachversicherungen
Spezialistin für Schadensregulierung


Spezialistin für Kundenservice
Spezialistin für Sachversicherungen


Social Media Manager
Content Creator
Eventmanager
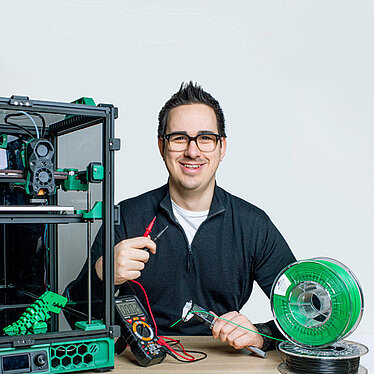

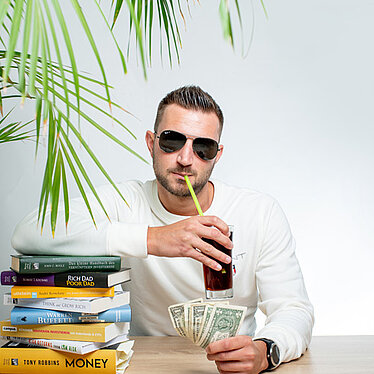

Geschäftsführer
Leiter Beratung Heilberufe
Finanz- & Versicherungsspezialist


Social Media Manager
Content Creator


Geschäftsführer
Leiter Beratung Beamte & öD
Finanz- & Versicherungsspezialist


Spezialistin für Kundenservice
Spezialistin für Risikoprüfung


Finanz- & Versicherungsspezialist


Geschäftsführer
Leiter Unternehmensentwicklung
Justiziar





Lass uns deine Fragen gerne persönlich klären. Wir freuen uns auf dich!